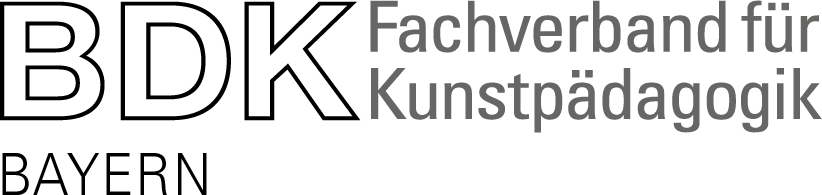Bildungspolitisches Manifest zu Interkultur/Transkultur in der Kunstpädagogik
Das Nürnberg-Paper 2013 hat eine Entwicklungsgeschichte, die auf einem partizipativen Prozess beruht. Die Vorläuferversion von 2012 (veröffentlicht in der Publikation revisit1) fasste die zentralen Ergebnisse des ersten Kongresses zum Thema Interkultur. Kunstpädagogik remixed zusammen. Dieser Kongress fand im Rahmen des Bundeskongresses der Kunstpädagogik (BuKo12) statt und wurde vom 20.–22. April 2012 vom BDK Bayern, der TU Dortmund und der Universität Erlangen-Nürnberg in Kooperation mit der Stadt Nürnberg veranstaltet. Vorbereitet auf dem Forum Interkultur bei der Hauptversammlung des Fachverbandes für Kunstpädagogik BDK e.V. im März 2012 in Wolfenbüttel, wurde das Nürnberg-Paper dort von den über 150 Teilnehmenden in Workshops weiterentwickelt und schließlich von einem Redaktionsteam ausgearbeitet. Auf dem Nürnberger Kongress wurden in den dortigen Workshops erarbeitete Anregungen ergänzt, das Papier im Abschlussplenum vorgestellt und die Weiterarbeit daran beschlossen. Diese wiederum geschah durch Einladung nicht am Prozess beteiligter Expertinnen und Experten, das Nürnberg-Paper zu kommentieren. Viele haben diese Einladung dankenswerterweise angenommen. Die Kommentare sind ebenfalls in revisit veröffentlicht.2 Die nun vorgelegte Fassung berücksichtigt diese und weitere3 äußerst wertvolle Anregungen. Dieser partizipative Entstehungsprozess will die Diskursmacht, die jede Formulierung von Handlungsempfehlungen mit sich bringt, durch eine diskursive, vielstimmige Praxis zumindest absichern. Der Redaktionsprozess wurde durch Barbara Lutz-Sterzenbach, Ansgar Schnurr und Ernst Wagner gestaltet.
Das Nürnberg-Paper bezieht sich zum einen auf den aktuellen erziehungs- und kulturwissenschaftlichen Diskurs in Deutschland, in der Pädagogik der Vielfalt und Inklusionspädagogik als wesentliche gesellschaftspolitische Aufgaben erkannt wurden. Es bezieht sich aber auch auf nationale und internationale Positionen wie das UNESCO Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen (2005), die UNESCO Seoul-Agenda (2010), die Positionen des Runden Tischs Interkultur beim Deutschen Kulturrat sowie die Ansätze im Abschlussbericht der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland des Deutschen Bundestags (2007).
Die hier formulierten Leitlinien und Handlungsempfehlungen richten sich an die Verantwortlichen in Kunstpädagogik und Kunstvermittlung auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene: in den Schulen (Lehrkräfte und Schulleitungen), in kulturellen Einrichtungen (Vermittlerinnen und Vermittler sowie Leitungen), an Hochschulen (Forscherinnen und Forscher sowie Lehrende), in Verwaltungen (Behörden und Ministerien) sowie in der Politik (Verbände wie Volksvertreterinnen und -vertreter). All diese sind aufgefordert, an der Umsetzung der Handlungsempfehlungen mitzuarbeiten.
Das ganze Paper zum download (pdf) hier: