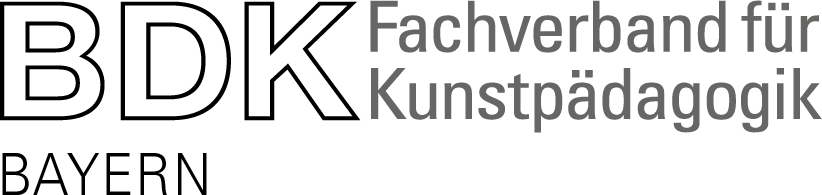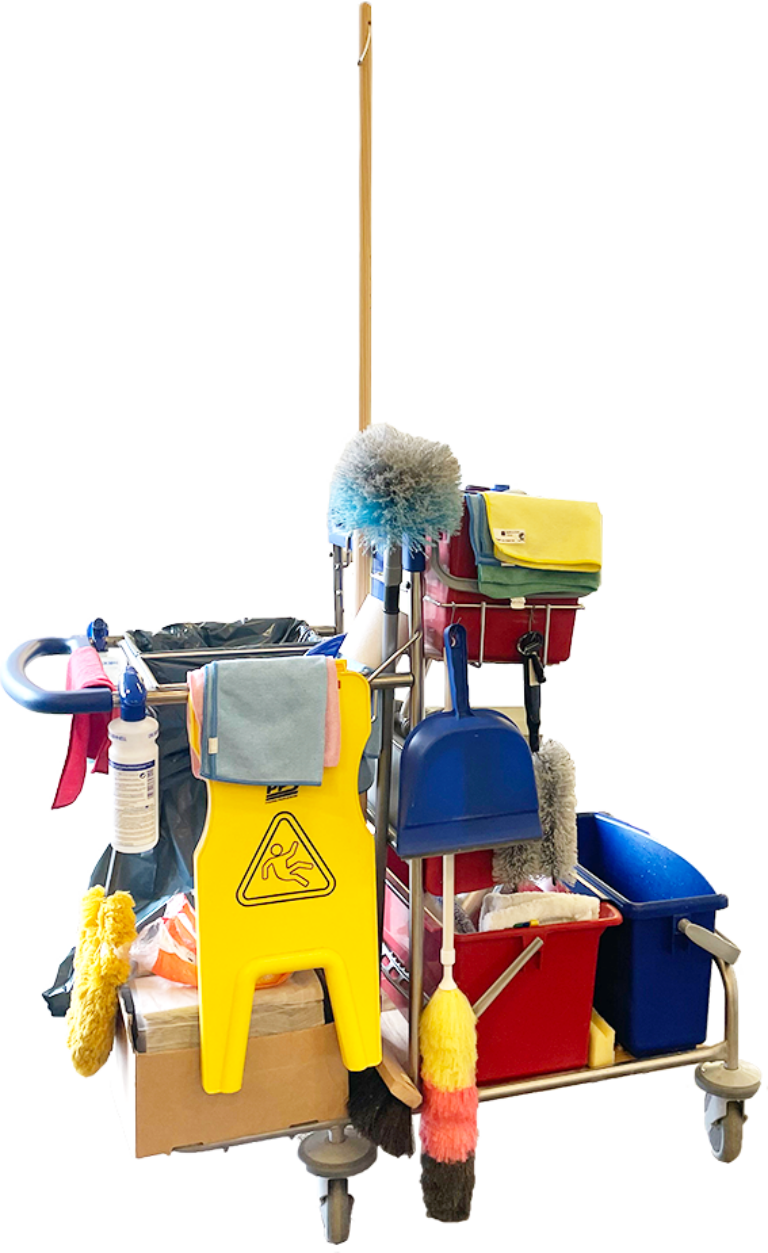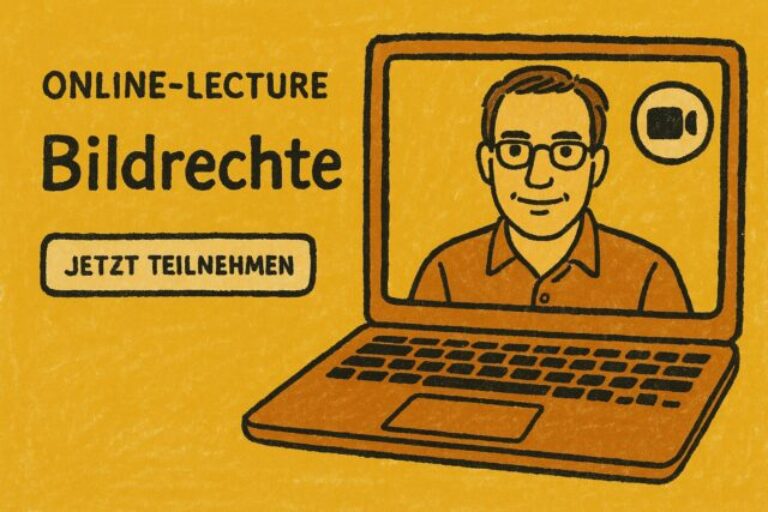Freitag, 16. Oktober 2026
Blicke verschieben – Perspektiven wechseln
Programm
(vorläufig)
9.00 Uhr Foyer Erdgeschoss
Anmeldung, Kaffee, Tee
09.30 – 12.00 Uhr Auditorium – Erdgeschoss Raum 1001
Begrüßung
Prof. Dr. Constanze Kirchner, Universität Augsburg
Franziska Seitz-Vahlensieck, Vorsitzende des Fachverbands für Kunstpädagogik, BDK Bayern e.V.
OStRin Hannah Köhnlein, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
10.00 – 10.30 Uhr
Den Blick weiten – Vermittlungskonzepte zu Antidiskriminierung und Empowerment
Sarah Bergh, Mitarbeiterin im Bereich Politische Bildung am Pädagogischen Institut – Kommunales Bildungsmanagement des Referates für Bildung und Sport der Stadt München
10.45 – 11.15 Uhr
Zur ästhetisch-politischen Dimension des Designs
Prof. Dr. Felix Kosok, Associate Professor für Grafikdesign, German International University in Berlin
11.30 Uhr -12.00 Uhr
Perspektivwechsel als Motor transkultureller Kompetenz
Prof. Dr. Constanze Kirchner, Universität Augsburg
12.00 – 13.00 Uhr Erdgeschoss sowie 1. und 2. Obergeschoss
Rundgang durch die Ausstellung im Haus (wer mag) – Zeichnungen vom Vormittag anheften
Imbiss im Foyer Erdgeschoss
13.00 – 15.00 Uhr 1. und 2. Obergeschoss sowie Foyer Erdgeschoss
Arbeitsgruppen zum Thema „Perspektivwechsel initiieren“: Unterrichtsideen, analoge wie digitale künstlerische Verfahren und Designtechniken, die Perspektivwechsel einleiten
ca. 20 – 25 Arbeitsgruppen in Werkstätten, Seminarräumen und Ateliers
15.00 – 15.30 Uhr Foyer Erdgeschoss
Kaffee, Tee und Austausch – Foyer Erdgeschoss
15.30 – 17.00 Uhr Auditorium – Erdgeschoss Raum 1001
Vorstellung der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen zum Perspektivwechsel (3 min pro AG)
Moderation: Franziska Seitz-Vahlensieck
Workshops KPT 2026 – Ideen für den Unterricht (vorläufig)
Die Workshops sind für alle Schularten und Schulstufen geeignet und orientieren sich am bayerischen LehrplanPLUS für das Fach Kunst. Die Lernbereiche Bildende Kunst, Gestaltete Umwelt/ Architektur, Angewandte Kunst/ Design, Visuelle Medien sowie Lebens-, Erfahrungs- und Fantasiewelten werden in den Workshop-Angeboten mit verschiedenen Themen und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen abgebildet.
Das Erlernen und Vertiefen spezifischer Techniken und Verfahren in verschiedenen Sparten (z.B. Malerei, Grafik, Bildhauerei, Medien, Umwelt- und Produktgestaltung, Performance) ist ebenso Ziel der Workshops wie das Kennenlernen spezifischer Methoden der Kunstrezeption, auch im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Übergeordnete Themen wie Nachhaltigkeit, Transkulturalität und Kreativität spiegeln sich in den Inhalten der Workshop-Angebote deutlich wider.
| Workshops 1. Prof. Dr. Nicole Berner, FAU Nürnberg „Ist das kitschig!“ – Wertzuschreibungen reflektieren und Kreativität fördern Kitsch und Cuteness prägen in vielfältiger Weise die ästhetischen Lebenswelten von Schüler:innen: von Emojis, Memes und Social-Media-Ästhetiken bis hin zu Souvenirs, DIY-Kultur und Pop-Art. Beide Kategorien sind in Alltags- und Jugendkulturen ebenso präsent wie in der zeitgenössischen Kunst, wo sie zunehmend als Gegenstand kritischer Reflexion verstanden werden. In dem Workshop erfahren Kunstlehrpersonen, wie sich kitschige, niedliche und ironische Bildwelten im Kontext von KitschArt und deren Erweiterungen nutzen lassen, um ästhetische Urteilsfähigkeiten von Schüler:innen zu fördern. Der Workshop verbindet Einblicke in zeitgenössische Positionen (z. B. Jeff Koons, Takashi Murakami) mit praktischen Ideen und Übungen. Lehrpersonen reflektieren eigene Sichtweisen, analysieren ambivalente Werke und entwickeln Unterrichtsideen, die Schüler:innen dazu anregen, unterschiedliche ästhetische Urteile zu formulieren und die Perspektiven anderer zu würdigen. Die Teilnehmer:innen probieren selbst den Einsatz von kitschigen und cute Bildmotiven aus, etwa durch Collagen oder digitale Gestaltungen, und erweitern ihr Vorstellungs- sowie Reflexionsvermögen. Ziel ist es, Kreativität, kritisches Denken und Ambiguitätstoleranz im Unterricht zu fördern, ästhetische Urteile über „kitschig“ und „cute“ im Kontext Bildender Kunst bewusst zu reflektieren und die Vielfalt von Wahrnehmungen und Perspektiven wertschätzend zu berücksichtigen. |
| 2. Werner Bloß, Gymnasium Wendelstein Ich im Bild – praktische Werkerschließungen mit Hilfe digitaler Interventionen in Sekundarstufe 1 Im Workshop sehen wir uns einfache und schultaugliche Methoden des digitalen Freistellens und Collagierens an. Wir tauschen uns über einfache (und ggf. von den Teilnehmer:innen mitgebrachte) Möglichkeiten der digitalen Werkerschließung aus und testen fachdidaktisch interessante Anforderungen und Anwendungsmöglichkeiten dieser Techniken. Daraufhin setzen wir uns digital selbst ins Kunstwerk, (inter-) agieren dort und interpretieren esdurch unsere Intervention neu. Zum Abschluss sichten wir die Ergebnisse und reflektieren mögliche Folgen für die – praktische – Werkerschließung im Fach Kunst unter technischen, sozialen, individuellen und globalen Fragestellungen. |
| 3. Verena Dietrich, Lehrerin Mittelschule/ Lehrstuhl Kunstpädagogik Vergrößerte Geheimnisse Im Workshop „Vergrößerte Geheimnisse“ treten kleine Samen aus dem Verborgenen ins Sichtbare. Unscheinbare Körner werden vergrößert, genau betrachtet und mit handgeschöpftem Papier und Draht als filigrane Skulpturen nachgebildet. Draht spannt Linien und Räume, Papier lässt sich falten, umhüllen und modellieren – gemeinsam entstehen Objekte, die zwischen Stabilität und Leichtigkeit oszillieren. Durch diesen kreativen Prozess erleben die Teilnehmenden einen Perspektivenwechsel: das Kleine wird groß, das Alltägliche überraschend, das Fragile kraftvoll. Zwischen Material und Form eröffnet sich ein Raum des Experimentierens, der Wahrnehmung, Gestaltung und Staunen miteinander verbindet. Lehrplanbezug: Bildnerisches Gestalten / Kunst (Sek I/II): Auseinandersetzung mit Naturformen, Transformation von Beobachtung in künstlerische Ausdrucksformen. Kompetenzbereiche: Wahrnehmung und Darstellung (genaues Beobachten), Produktion (dreidimensionale Objekte mit Mischtechniken), Reflexion (Diskussion über Materialität und Gestaltung). |
| 4. Clemens Höxter, Vorstand Fachverband für Kunstpädagogik e.V. Blicke verschieben – Perspektiven neu gestalten: Migration in der Bildenden Kunst Der LehrplanPLUS hebt die Relevanz gesellschaftlicher Themen im Rahmen übergreifender Bildungsziele (Bildung für Nachhaltige Entwicklung, BNE) hervor. Insofern bietet das Thema „Migration in der Bildenden Kunst“ einen interessanten und lehrplankonformen Zugang im Kunstunterricht zur Problematik der Migration und ist didaktisch wie fachlich insbesondere mit dem bayerischen LehrplanPLUS für das Fach Kunst (alle Schularten) vereinbar. Migration kann so im Kontext von Flucht, Klimawandel, Kolonialgeschichte, Urbanisierung u. v. m. gesehen werden. Themen wie Migration, Umzug, Landnahme lassen sich hier historisch thematisieren mit dem Ziel, Werke der Kunstgeschichte und hybride, neue Bilder nicht aus einer Perspektive zeigen, sondern Mehrstimmigkeit zuzulassen und neue Sichtweisen zu erproben. Praktische Übungen zu kompetenzorientierten Aufgabenbeispiele von Collage / Mixed Media über Visuelle Tagebücher bis zu Kunstaktionen im öffentlichen Raum bieten Anknüpfungspunkte für gestalterische Unterrichtsideen und fördern die kreative Ausdrucksfähigkeit. |
| 5. Tina Keck, Lehrerin Realschule / Michaela Almog, Institut für Kunstpädagogik LMU München Den Körper ins Spiel bringen Perspektivwechsel werden möglich, wenn wir uns bewegen, mit dem Körper ebenso wie im Denken. Im Austausch miteinander lernen wir andere Standpunkte und neue Sichtweisen kennen. In diesem Workshop möchten wir erproben, wie die Bewegung im Raum, die Interaktion innerhalb der Gruppe und die Materialerfahrung als Impulse für die Ideenfindung und für Gestaltungsentscheidungen im Kunstunterricht genutzt werden können. Mit Hilfe performativ-spielerischer Methoden werden wir uns dem altbekannten Material Papier auf neue Weise nähern und installative Arbeiten entwickeln, die Wahrnehmungen verschieben und neue Betrachtungsweisen zulassen. Performative Zugänge sind in allen Schularten der Sekundarstufe I in Bayern verankert: In der Realschule erleben Lernende performative Kunst- und Spielformen, in der Mittelschule arbeiten sie mit Installation bzw. Performance, im Gymnasium gestalten sie Interaktion und Inszenierung im Raum. |
| 6. Prof. Dr. Johannes Kirschenmann, ehem. AdBK München Chancen des Perspektivwechsels im Vergleichenden Sehen Die Gegenwartskunst wartet andauernd mit Zitaten, Remakes oder Reenactments auf. Das fordert die Kunstpädagogik auf, nach dem Bildungspotenzial dieser künstlerischen Methode zwischen Tradition und Gegenwart zu fragen: Wie schult ein „Vergleichendes Sehen“ Blick und Erkenntnis gegenüber der Form? Welche kulturellen und künstlerischen Kontexte werden im Original und im Remake/Zitat sichtbar? Stiftet das Displacement von Form und Bedeutung eine These? Kunstdidaktisch geht es übergeordnet um die Varianten des Zitierens als Motor künstlerischer und gestaltender Kreativität. Im Workshop werden zahlreiche Beispiele dieser künstlerischen Strategie von Duchamp bis heute vorgestellt und als Material für Unterricht bereitgestellt. Daneben treten Dokumentationen und die Diskussion von Arbeiten im Themenfeld mit Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden. Abschließend werden die Potenziale von KI mit Versuchen vor Ort ausgelotet. |
| 7. Prof. Dr. Barbara Lutz-Sterzenbach, Kunstpädagogik und Visual Literacy Universität Passau Künstlerinnen Welche Bilder sind Gegenstand der Auseinandersetzung für Rezeption, Reflexion und Produktion im Kunstunterricht? Welche fehlen? Im Kanon an Bildern, die über Lehrmedien und Curricula für den Kunstunterricht in Deutschland vermittelt werden, gibt es bisher keine umfassende Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. Bilder von Künstlerinnen sind sowohl in Lehrmedien als auch in Curricula als Gegenstand der Rezeption, Reflexion und Produktion unterrepräsentiert. Auch queere Perspektiven bzw. Perspektiven nicht binärer Personen fehlen. So finden sich z.B. im Lehrplan für Realschulen in Bayern für die Jahrgangsstufen 5-10 insgesamt nur drei Künstlerinnen – in diesem Fall die Niki de St. Phalle, Maria Lassnig und Cindy Sherman. Diesen drei Künstlerinnen stehen 51 männliche Künstler zur Seite – oder gegenüber. Das Gleiche gilt für die Grundschule – mit insgesamt nur zwei Künstlerinnen, nämlich Niki de St. Phalle und Sonja Delaunay unter einer Vielzahl männlicher Künstler. Trotz veränderter Ausstellungspraxen im globalen Kunstsystem und veränderten Diskursen in der Kunstgeschichte wird der bestehende Bildkanon kaum um weibliche Perspektiven ergänzt! Wir tauschen uns über KÜNSTLERINNEN aus und ergänzen ein Narrativ von Kunstgeschichte, das Künstlerinnen – sollte es ihnen historisch möglich gewesen sein, als solche zu arbeiten – gerne übersah. Frauen war der Weg in die Kunstakademien lange verwehrt. Männliche Maler dominierten über Jahrhunderte die Kunstszene und schufen Bilder, die mit weiblichen Akten vor allem für männliche Rezipienten konzipiert war. Do women have to be naked to get in the Met. Museum? fragte denn auch das Künstlerinnen-Kollektiv guerilla girls provokativ im Jahr 1989. |
| 8. Prof. Dr. Monika Miller, PH Ludwigsburg Bildtransfer mit Gelplatte Der Workshop widmet sich dem kreativen Zusammenspiel von Drucktechnik und Collage als künstlerischer Strategie. Ausgehend von fotografischen und grafischen Vorlagen entwickeln die Teilnehmenden durch mehrschichtige Gel-Printing-Verfahren neue Bilder als gedruckte Collagen. Die Gelplatte dient dabei als Experimentierfeld, auf dem Fragmente, Abdrucke und Überlagerungen in einen dialogischen Prozess treten. Spuren, Brüche und Zufälle werden produktiv genutzt, um neue visuelle Verbindungen und narrative Ebenen zu schaffen. Im Mittelpunkt steht das forschende und spielerische Erproben von Material und Oberfläche – von transparenten Farbschichten bis zu strukturierten Papierelementen. Die Methode des Bildtransfers erweitert die Collage um druckgrafische Dimensionen und eröffnet im kunstpädagogischen Kontext vielfältige Ansätze für experimentelles, prozessorientiertes Arbeiten zwischen Zufall, Komposition und Reflexion. |
| 9. Susanne Nickel, Druckgrafikerin Lehrstuhl Kunstpädagogik Kollaborative Kaltnadelradierungen Die Druckgrafik zwingt zum Perspektivwechsel durch Spiegelung, Umkehrung, Linien als Spuren, die unmittelbar in die Platte geritzt werden und die Mehrdeutigkeit von Bildern. Unvorhersehbarkeit des Druckprozesses, Zulassen von Brüchen und Überlagerungen, kollaboratives Arbeiten verstärkt diese Erfahrung, indem verschiedene Handschriften, Ideen und Sichtweisen zusammengeführt werden. Der Workshop lädt die Teilnehmenden ein, die Technik der Kaltnadelradierung als Mittel des Perspektivwechsels und der Kollaboration zu erfahren. Das künstlerische Arbeiten in gemeinschaftlichen Prozessen fördert Ambiguitätstoleranz und ermöglicht überraschende ästhetische Ergebnisse. Was bedeutet „Perspektiven wechseln“ in der Kunst? Erste Motive können z.B. ein Selbstporträt, sich gegenseitig zeichnen oder ein inneres Bild, auch ungegenständlich sein – dann Weitergabe der Platte und Ergänzung durch eine andere Person. Platten tauschen: gegenseitige Ergänzung, Überzeichnung und Überlagerung. Drucken der entstandenen Platten; auch experimentelle Ansätze wie Überlagerungsdruck sind denkbar. Schließlich Reflexion und Austausch über die gemachten Erfahrungen, künstlerischen Ergebnisse und pädagogische Übertragbarkeit. |
| 10. Prof. Dr. Martin Oswald, PH Weingarten Farben erleben, mit Farben gestalten Die Beschäftigung mit dem Thema FARBE erfordert einen unablässigen Perspektivwechsel. Allein schon der Unterschied zwischen dem Umgang mit Pigmenten und farbigem Licht erfordert ein vollständiges Umdenken. Denn die subtraktive und die additive Farbmischung funktionieren nach unterschiedlichen Mechanismen. Hinzu kommt die Tatsache, dass Farben an sich gar nicht existieren, sondern eine Erfindung unseres Gehirns sind. Nur so ist es auch zu erklären, dass unser Farbsinn so stark manipulierbar ist. Von der Grundschule bis zur Sekundarstufe taucht „Farbe“ daher im Lehrplan wiederholt auf verschiedenen Anforderungsniveaus auf: Sei es im Sinne von Farbmischübungen bis hin zum gestalterischen Einsatz im Bereich von Medien und visueller Kommunikation. Der Workshop macht zunächst mit ein paar spannenden Ergebnissen aus der Forschung zur Farbwahrnehmung bekannt, bevor wir uns in eigenen Übungen mit der Farbgestaltung und Farbwahrnehmung befassen. Ergänzt wird der Workshop mit Hinweisen zu fachdidaktisch hilfreichen Materialien. |
| 11. Norbert Pauli, Lehrer Mittelschule/ Lehrstuhl Kunstpädagogik Zweck entfremdet – Perspektivwechsel mit Holz im Raum. Holzutensilien aus dem Küchenalltag und traditionelles Werkzeug Im Alltag übersehen wir viele Dinge – besonders jene, die nützlich, einfach oder alltäglich erscheinen. Was aber passiert, wenn wir einem Holzlöffel seine Funktion nehmen? Wenn ein Schneidebrett zur Bühne wird? Wenn ein Zahnstocher nicht mehr in der Küche, sondern im Kunstkontext steht? In diesem Workshop erleben und reflektieren Kunstlehrkräfte einen künstlerischen Perspektivwechsel, indem aus alltäglichen, funktionalen Küchengegenständen aus Holz (z. B. Holzlöffel, Zahnstocher, Essstäbchen, Holzbesteck etc.) ungewöhnliche, irritierende, poetische oder humorvolle Raumobjekte entstehen. Ganz ohne Schrauben oder Nägel, nur mit klassischen Holzverbindungen und traditionellen Werkzeugen (Sägen, Raspeln, Bohrer etc.) werden kleine, räumliche Assemblagen erschaffen. Ziel ist es, diesen kreativen Umgang mit Material, Form und Deutung auch auf den Kunstunterricht zu übertragen – praxisnah, schülerzentriert und schulartspezifisch adaptierbar. |
| 12. Christopher Regl, Lehrbeauftragter, Institut für Kunstpädagogik LMU München „ Ich in dir“ (Rigipsplatten, Dispersionsfarbe, Spiegelfolie) Dieser Workshop bietet die gestalterische Auseinandersetzung mit dem Thema Diversität. Dabei ist die direkte Begegnung mit echten Menschen, die im Alltag vieler Schüler*innen und Lehrkräfte eher wenig beachtet werden, performativer Teil des Gestaltungsprozesses. Der Lehrplan für die bayerische Mittelschule sieht im Lernbereich 1 der neunten Jahrgangsstufe in den Inhalten des die Auseinandersetzung mit Werken von Künstlerinnen und Künstlern des 20. und 21. Jahrhunderts wie Niki de Saint Phalle und deren künstlerischen Positionen sowie den Themen Pop Art, Installation und Performance vor. Bevor sie großformatige Portraits gestalten, führen die Teilnehmer*innen in Kleingruppen Gespräche mit Personen, die ihnen im Umfeld von Schulhaus und Uni zwar oft begegnen können, aber wohl nicht immer bewusst beachtet werden: Kindergarten- und Grundschulkindern, Senior*innen, Menschen mit Beeinträchtigung im öffentlichen Verkehr, Schüler*innen in Deutschlernklassen, Putzpersonal. Die genaueren biografischen Informationen entnimmt man schließlich einem QR-Code. Rigips erfüllt die Voraussetzungen der schulischen Brandschutzbestimmungen. Spiegelfolien ermöglichen wortwörtliche Reflexion. |
| 13. Prof. Dr. Oliver M. Reuter, Universität Würzburg Materielle Transformationen in der GS Der Workshop lädt Lehrkräfte ein, das Konzept der materiellen Transformation im Kunstunterricht praktisch zu erproben und didaktisch zu reflektieren. Im Mittelpunkt steht die Herstellung von Material, beispielsweise Knete, das anschließend in gestalterischen Prozessen erprobt wird. Die Teilnehmenden erleben, wie durch eigenes Produzieren Materialbewusstsein und Nachhaltigkeit gefördert werden können, intensives sinnliches Wahrnehmen ermöglicht wird. Neben der praktischen Arbeit werden die organisatorischen Voraussetzungen (Materialien, Raum, Ablauf) sowie methodisch-didaktische Umsetzungsmöglichkeiten thematisiert. Konkrete Beispiele aus dem Kunstunterricht verdeutlichen, wie materielle Transformation im Lehrplan verankert ist und wie sich produktive Verbindungen zu weiteren Fächern herstellen lassen, etwa zu Deutsch oder zum Sachunterricht. Der Workshop eröffnet damit Impulse für einen lebendigen, experimentellen und fächerübergreifenden Kunstunterricht. |
| 14. Sonnja Genia Riedl, ISB-Fachreferentin Medienpädagogik und Film VideoSTILL als kollaborative Geste Im Kunstunterricht lohnt es sich, das komplexe Medium Film auf wenige Phasenbilder einer Bewegungssequenz zu reduzieren, um Filmsprache zu lernen. Es ist spannend, diese kurze Bewegung mit dauernd wechselnden Figuren, z.B. einer ganzen Klasse, darzustellen, die nur dann in schneller Abfolge schlüssig als EINE filmische und gestische Bewegung interpretiert werden kann, wenn die einzelnen Bewegungsphasen, die aufeinander folgen, jeweils ähnlich genug sind, aber nicht identisch. Unsere gemeinsame Aktion steht unter dem Motto „videoSTILL“ und reflektiert sowohl unsere Wahrnehmung im eigenen Blick, als auch das Stillhalten in einer Haltung bzw. die Unbewegtheit statischer Phasenfotos, die passend fotografiert und zusammengesetzt somit eine kurze Filmsequenz als Trickanimation ergeben können, obwohl sich die Personen der Bilder permanent ändern. Wir entscheiden uns gemeinsam für zwei unterschiedliche Haltungen, die den Anfangs- und Endpunkt einer Geste markieren, die wir als Gruppe darstellen wollen. Im zweiten Teil unserer Aktion stellen wir uns alle gleichzeitig so auf, dass gemeinsam eine möglichst gute Phasenverteilung von den zwei dann ineinander übergehenden Haltungen erreicht wird. Diese figurative Portrait- oder Bewegungsfolge als skulpturale Performance vermischt unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten somit zu einer kurzen, kollaborativen Geste. Im dritten Teil unserer Aktion erfassen wir die fotografierten Phasenfotos mit einem digitalen Gerät (Tablet) in einem dort installierten Animationsprogramm (z.B. DaVinci Resolve), und sortieren die einzelnen Bilder so, dass sie eine möglichst fließende filmische Animation ergeben. Die Trickanimation exportieren wir als kurze Sequenz und betrachten die filmische visuelle Wirkung. In einer weiteren Unterrichtsphase könnte ein solch entstandener Clip dann mit Sprache oder Musik experimentell vertont werden. In einer abschließenden Reflexion werden wir die Mediendaten gemeinsam nach Absprache löschen, und die Herausforderungen und Variationsmöglichkeiten einer solchen Unterrichtseinheit für den Kunstunterricht in verschiedenen Schularten und Schulstufen beleuchten. |
| 15. Benedikt Riedl, Lehrer Realschule / Lehrstuhl Kunstpädagogik Malerische Abstraktion – mikroperspektivische Realitätsfragmente als Ideengeber für abstrahierte/abstrakte Bildkompositionen Der geläufige Begriff der Abstraktion ist nicht nur ein künstlerisch-gestalterisches Prinzip. Er bezeichnet vielmehr ein grundlegendes intellektuelles Konzept: das Weglassen von Details und die Überführung auf eine einfachere Ebene, wie es auch in anderen Wissenschaften angewandt wird. Diesem Prinzip folgend arbeiten die Teilnehmer mit einfachen Alltagsgegenständen, die sie dann durch Zusammenstellen, Anordnen und Fotografieren aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang lösen. Der Perspektivwechsel – im Weglassen von Details, in der Neuordnung und im gezielten Zoomen – bildet das kreative Fundament für „Skizzen“, die wiederum als Grundlage für abstrahierte oder völlig abstrakte Malereien dienen. Solche reduzierten Vorlagen eröffnen Jugendlichen eine besondere Möglichkeit: Obwohl ihr Gestaltungswille meist auf realistische Darstellungen gerichtet ist und sie deren Umsetzung häufig noch überfordert, können sie hier gleichsam realistisch nach Vorlage arbeiten – und gelangen dennoch zu einem abstrakten Ergebnis. Die noch erkennbaren Realitätsfragmente schaffen dabei ein Spannungsfeld zwischen Präzision und Lockerheit, das auf allen Kompetenzniveaus und Altersstufen produktives Experimentieren ermöglicht. In der gemeinsamen Bildbesprechung werden abschließend Schwierigkeiten und Chancen bei der Bewertung von abstrakten Arbeiten im Kunstunterricht diskutiert und gemeinsam praxisnahe Lösungsansätze entwickelt. |
| 16. Prof. Dr. Christian Römmelt, PH Weingarten Storytelling kreativ: Comics animieren In der digitalen Welt eröffnen sich für Comic-Enthusiast:innen ganz neue Möglichkeiten, Geschichten lebendig zu erzählen. Mit iPad-Apps wie Procreate und Procreate Dreams können Schüler:innen nicht nur Comics zeichnen, sondern diese auch mit Animationen aufs nächste Level bringen. Einzelne Panels lassen sich gezielt animieren, um Emotionen, Bewegungen oder besondere Effekte hervorzuheben und die Story noch eindrucksvoller zu gestalten. Durch die Integration von Artivive wird das Comic in die erweiterte Realität (AR) transportiert – Leser:innen können so mithilfe ihres Smartphones oder Tablets den Comic in einer völlig neuen Dimension erleben. Der Workshop richtet sich speziell an Lehrkräfte, die Ideen für einen kreativen Kunstunterricht mit digitalen Medien suchen. Sie erhalten nicht nur das notwendige technische und didaktische Wissen, sondern profitieren auch von zahlreichen Praxistipps und inspirierenden Beispielcomics, die von Schüler:innen selbst gestaltet wurden. Schritt für Schritt lernen Sie, wie Sie ein eigenes Comicprojekt realisieren und dabei die Begeisterung Ihrer Schüler:innen für das Erzählen, Zeichnen und Animieren wecken. So entstehen einzigartige Werke, die weit über das klassische Comicformat hinausgehen und das kreative Potenzial der Lernenden voll ausschöpfen. |
| 17. Wolfgang Schiebel, Realschullehrer i. R. / Fachverband für Kunstpädagogik Bayern e.V. Workshop: 3D-Druck / Hochdruck Der Hochdruck ist wohl eine der ältesten Drucktechniken, denkt man nur an das Bedrucken von Textilien mittels „Modeln“ oder den Buchdruck, der vor allem durch Gutenbergs Erfindung des Druckens mit beweglichen Lettern für eine informationstechnische Revolution sorgte. Er findet sich bis heute im Oeuvre namhafter Künstler und erlebt gerade eine Renaissance in Graphic Novels. Die relativ einfache Herstellung des Druckstocks macht ihn zur idealen Technik zum Einstieg ins Drucken im Unterricht aller Jahrgangsstufen und Schularten, denkt man nur an den Kartoffeldruck oder an den Linolschnitt, sodass er sich auch in allen Lehrplänen findet. Dem gegenüber steht der 3D-Druck, wobei man ja wohl eher weniger von einem Druck sprechen kann, wird ja hier– außer in der Extrusionsdüse – Druck ausgeübt wird. Dennoch ist es möglich Druckstöcke in diesem Verfahren herzustellen, ohne sich blutige Finger zu holen, ja ganz ohne handwerkliches Geschick. So stellt sich nun die Frage, ob sie zusammen angewendet zu besseren, anderen oder innovativen Ergebnissen führen. Dies auszuloten ist Ziel des Workshops, wobei praktische Versuche hier zu anwendungsspezifischen Hinweisen führen sollen. |
| 18. Markus Schlee, Gymnasiallehrer / Lehrstuhl Kunstpädagogik WACHS / GIPS / BETON / STYRODUR – praxisnahe Anwendungen für verschiedene Schultypen und Jahrgangsstufen Es werden inhaltliche Impulse gegeben, die sich auf das Rahmenthema „Perspektivwechsel“ beziehen, und konkrete Unterrichtsbeispiele hierzu aufgezeigt. Der Schwerpunkt im Bereich Wachs liegt bei der Modellierung menschlicher Körper und der Darstellung möglicher Interaktionen zwischen den entstandenen Figuren (Themen bspw.: Klassenparty / Denkmal und Betrachter / Käfig innen-außen …) auch im Kontext untenstehender architektonischer Gestaltungen oder Dioramen. Gipskarton oder alternativ papierkaschierte Hartschaumplatten werden als Grundmaterialien für schnell gebaute Architekturmodelle oder auch Großplastiken analysiert und erprobt. Ebenso können Überlegungen für installative Anwendungen oder plastische Raumgestaltungen im Sinne von Environments angestellt werden. Modulare Systeme bieten schließlich die Möglichkeit Partner- und Gruppenarbeiten konfliktarm zu gestalten und individuelle Lösungen in Metaobjekte zu integrieren. Auch Grundschülern ist es bereits möglich in Tonblöcke negativ Formen herauszuarbeiten, die dann mit Beton ausgegossen werden. Die Umkehrung in der Ausgestaltung der Negativform bewirkt eine bewusstere Wahrnehmung von Konkavem und Konvexem – auch direkte Abformungen sind in dieser Technik möglich. Das Charmante an dieser Materialkombination Ton-Beton ist, dass Ton im feuchten Zustand weich bleibt, Beton jedoch Feuchtigkeit zum Abbinden benötigt, sodass nach dem Aushärten des Betons, der Ton leicht abgenommen werden kann. Styrodur kann sowohl geschnitzt werden (z.B. für Puppenbau) wie auch in größeren Platten zu tragfähigen konstruktiven Objekten verarbeitet werden. Die Verklebung findet einfach mit Heißkleber statt. Hier sind sowohl plastische wie installative Einsatzmöglichkeiten – auch in Verbindung mit anderen Materialien – möglich. |
| 19. Nicola Pauli, Leitung Kunstpädagogik Kunst_Raum Weiherhof/ Dr. Christiane Schmidt-Maiwald, Gymnasium / Lehrstuhl für Kunstpädagogik Stoffmuster als transkulturelles Medium – Kulturelle Codes, Stoffdrucktechniken und Transformationsprozesse am Beispiel afrikanischer Wax-Print-Stoffe Der Workshop gibt Einblick in die Geschichte der afrikanischen Wax-Print-Stoffe, die ein anschauliches Beispiel für eine kulturelle Durchmischung von Technikwissen und Musterbedeutung sind und somit als Vermittlungsgegenstand transkulturelle Perspektiven ermöglichen. Die wachsbasierte Reservefärbetechnik der Wax-Print-Stoffe stammt ursprünglich aus Indonesien und wurde von niederländischen Händlern in Europa bekannt macht, industrialisiert und im späten 19. Jahrhundert dann in Westafrika vermarktet. Bei der Musterfindung näherte man sich zunehmend afrikanischen Mustervorlieben an. Heute entwickeln westafrikanische Designerinnen und Designer ihre eigenen Muster mit verschlüsselten Botschaften. Textilien haben also nicht nur funktionalen Charakter, sondern sind auch Bedeutungsträger und übermitteln über Schnitt, Farbe und Muster gewollt oder ungewollt Informationen und Botschaften über ihre Träger. So stellt der Stoffmusterdruck und seine Codes einen Unterrichtsgegenstand mit einem für Jugendliche interessanten Lebensweltbezug dar. Der Workshop widmet sich zunächst der Geschichte der Wax-Print-Muster und zeigt die Verbindungen zur Augsburger Textilindustrie auf, die bis heute Damast für die Herstellung der landestypischen von Männern getragenen Boubous nach Ghana liefert. Über die transkulturellen Aspekte werden Vermittlungsmethoden der kulturellen Bildung und ästhetischen Forschung diskutiert. Im praktischen Teil werden Muster entwickelt und mit Stempel und Schablonendruck umgesetzt. |
| 20. Anja Schönau, Akademische Rätin / Lehrstuhl für Kunstpädagogik Schwarzweiß – Objekte an der Schnittstelle zwischen Kunst und Design Im Keramik-Workshop „Schwarzweiß“ entdecken und erproben wir neue, unvertraute Strategien im Umgang mit Ton zur Herstellung individueller und ausdrucksstarker Schmuckstűcke an der Schnittstelle zwischen Kunst und Design. Uns beschäftigen u. a. Fragestellungen des Objekts im Objekt, der Verschränkung und Öffnung, des Blick- und Richtungswechsels. Japanische wie europäische Zugangsweisen faszinieren uns gleichermaßen. Alle benötigten Materialien (Skizzenpapier, Holzbrett, Töpferscheibe, Ton, Schlicker, schwarze Engobe, etc.) werden gestellt. Gerne können Sie Ihr eigenes Töpferwerkzeug wie Messer, Tondraht, Töpfernadel, Tonhölzer (zum Zuschnitt von Platten), Schlingen, Abziehklinge, Modellierhölzer, Schwämmchen, Pinsel, Bleistift, Lineal, Zirkel, Schere, Frischhaltefolie, Műllbeutel, Zeitungspapier mitbringen. Bitte bringen Sie zudem Einweghandschuhe und eine Schutzmaske mit. Alle entstandenen Objekte werden (sofern brennbar) anschließend im Schrűhbrand gebrannt und können zu einem Sammeltermin abgeholt werden. Dieser wird Ihnen per Mail noch nach dem Workshop bekannt gegeben. |
| 21. Prof. Dr. Frank Schulz, ehem. Universität Leipzig Das Prinzip des Demonstrationsraumes zur Verbindung produktiver, rezeptiver und reflexiver Aktivitäten im Kunstunterricht „Demonstrationsräume“ gehen auf Konstruktivisten wie El Lissitzky zurück und meinen ein verändertes Präsentationsprinzip bildnerischer Arbeiten im Unterschied zum tradierten Ausstellungsraum. Gezeigt werden in ihnen nicht nur einzelne Werke, sondern auch Konzept- und Hintergrundmaterialien sowie thematische, inhaltliche wie formale Rechercheergebnisse, Studien, Resultate der Reflexion von Bezugspunkten in Kunst und Wirklichkeit usw. Im Workshop wird dies am Beispiel erläutert. Im Mittelpunkt steht die Ideenentwicklung für die eigene Unterrichtspraxis. Unter einem ausgewählten Thema soll das Konzept für einen Demonstrationsraum entstehen, wobei unter „Raum“ nicht unbedingt ein Gebäudeteil zu verstehen ist, sondern ebenso räumliche Behältnisse wie Schachteln, Kartons, Kisten, KoWer u. Ä. Thematisch wird der Workshop an einer im Alltag und in der Kultur- und Kunstgeschichte verbreiteten Legende ausgerichtet: „Der Rattenfänger von Hameln“. |
| 22. Katharina Swider, Grundschule/ Lehrstuhl für Kunstpädagogik Experimentelle Tiefdruckverfahren ohne Presse – Miniatur-Drucke mit Tetra Pak® & Nudelmaschine Der Workshop vermittelt ein experimentelles und alternatives Verfahren zur Kaltnadelradierung mittels Tetra Pak ® und Nudelmaschine. Dabei fungiert die Tetra Pak ®- Verpackung (z.B. eine aufgeschnittene Milchtüte) als Druckstock, die Nudelmaschine als Presse und selbst die Radiernadel kann durch einen spitzen Bleistift ersetzt werden. Aufgrund des begrenzten Formats durch die Nudelmaschine für Druckstock sowie Papier, entstehen im Rahmen des Workshops kleine oder Miniatur-Drucke, die in einem Leporello oder einem Schraubverschluss-Diorama inszeniert werden können. Neben den einfarbigen, können auch mehrfarbige Tiefdrucke ausprobiert (à la poupée), diverse Spielarten des Reliefdrucks erprobt und evtl. Fehldrucke veredelt werden. Da weder eine Druckpresse noch kostenintensive Materialien erforderlich sind und die Handhabung der benötigten Werkmittel spielerisch gelingt, kann diese Technik in allen Schularten angewandt werden. Dies ermöglicht die Vermittlung des Tiefdruckverfahrens bereits im Kunstunterricht der Grundschule. Der Workshop schließt mit Anregungen für den Kunstunterricht für Grund- und weiterführende Schulen ab, die sich am aktuellen bayerischen Lehrplan PLUS orientieren. |
| 23. Mina Ton, PH Weingarten Transkulturelle Bildwelten in der Kunstvermittlung erforschen Wie können irritierende, ungewohnte oder fremd wirkende Bilder im Kunstunterricht genutzt werden, um neue Perspektiven zu eröffnen? In diesem Workshop begegnen die Teilnehmenden vielfältigen Bildwelten, die vertraute Seh- und Denkweisen hinterfragen. Momente der Irritation werden dabei nicht als Hindernis, sondern als Chance verstanden, eigene Wahrnehmungsmuster zu reflektieren und aufzubrechen. Über theoretische Impulse und praktische Übungen – etwa Schreibgespräche – setzen sich die Teilnehmenden gemeinsam mit Prozessen transkultureller Perspektivwechsel auseinander. Ziel ist es, Methoden kennenzulernen, die Offenheit fördern, stereotype Denkmuster hinterfragen und Lernende ermutigen, verschiedene Standpunkte einzunehmen. Der Umgang mit transkulturellen Bildwelten soll im Sinne der Ziele der kulturellen Bildung, die Lernenden darin unterstützen, die eigenen Perspektiven zu reflektieren und andere Sichtweisen wertzuschätzen. |
| 24. Vasilii Vikhliaev, Filmemacher, München „Übersetzen ist die Kunst des Scheiterns“ – Umberto Eco Der Workshop setzt sich mit dem bildnerischen wie akustischen „Übersetzen“ mit den Möglichkeiten der digitalen Technik auseinander. Wenn es keine Originale gibt, ist alles Übersetzung – und jede Übersetzung scheitert irgendwie. Wir übersetzen nicht sprachlich, sondern zwischen den Medien: Bilder werden zu Klängen, Klänge zu Bildern, Videos zu 3D-Räumen und audiovisuelle Archive zu maschinellen Lernmodellen. In meiner Arbeit „MEMORY SCANS” (2024) habe ich Kindheitserinnerungen aus Moldau verarbeitet. Dafür habe ich Fotos traditioneller Teppichmuster digital in Audiosignale umgewandelt und diese anschließend wieder in Bilder zurückverwandelt. So sind Klänge und Visualisierungen entstanden, die das Ausgangsmaterial erahnen lassen, aber eine eigene Ästhetik entfalten. In diesem Workshop lernen die Teilnehmer*innen verschiedene Übersetzungsmethoden des Digitalen kennen. Mithilfe von Open-Source-Tools können sie eigenes Material transformieren und die Einsatzmöglichkeiten im Kunstunterricht reflektieren. Ein Laptop ist von Vorteil, Vorkenntnisse sind nicht nötig. (iPad auch möglich) Theoretisch verorte ich diese Praxis im produktiven „Scheitern“ jeder Übersetzung. Dieses „Scheitern“ ist jedoch nicht als Mangel zu begreifen, sondern als produktiver Zustand, als Raum, in dem Sinn umgedeutet wird und in dem visuelle sowie akustische Spuren entstehen, die weder bloße Kopie noch reine Erfindung sind. Der Workshop knüpft demnach direkt an den Lernbereich 13.2 des bayerischen Gymnasiums an, in dem Transformation im Sinne einer Umgestaltung, eines Wandels verankert ist. |
| 25. Miriam El-Refaeih, BDK Bayern e.V., Gymnasium München Blick nach innen – Experimentelles Zeichnen und Meditation Der Workshop „Blick nach innen – experimentelles Zeichnen und Meditation“ richtet sich an Kunstpädagoginnen und -pädagogen, die ihre kreative Praxis erweitern und ihre pädagogische Arbeit bereichern möchten. In diesem praxisnahen Angebot verbinden wir meditative Techniken mit experimentellen Zeichenmethoden, um den Zugang zu inneren Bildern und persönlicher Ausdruckskraft zu fördern. Durch geführte Meditationen und achtsames Beobachten entwickeln die Teilnehmenden ein verstärktes Bewusstsein für Wahrnehmung, Konzentration und Emotionalität. Inhalte umfassen beispielsweise das Zeichnen im meditativen Zustand, das Arbeiten mit improvisierenden Linien sowie das Erkunden innerer Landschaften. Ziel ist es, Impulse für den Unterricht zu setzen, die Selbstreflexion und kreative Prozesse bei Schülerinnen und Schülern stärken und Alltagskompetenzen wie Achtsamkeit, Konzentration und Ausdrucksfähigkeit fördern. Der Workshop bietet Raum für individuelle Erfahrungen und den Austausch bewährter Methoden. |
| Ggf. folgen weitere Workshop-Angebote |