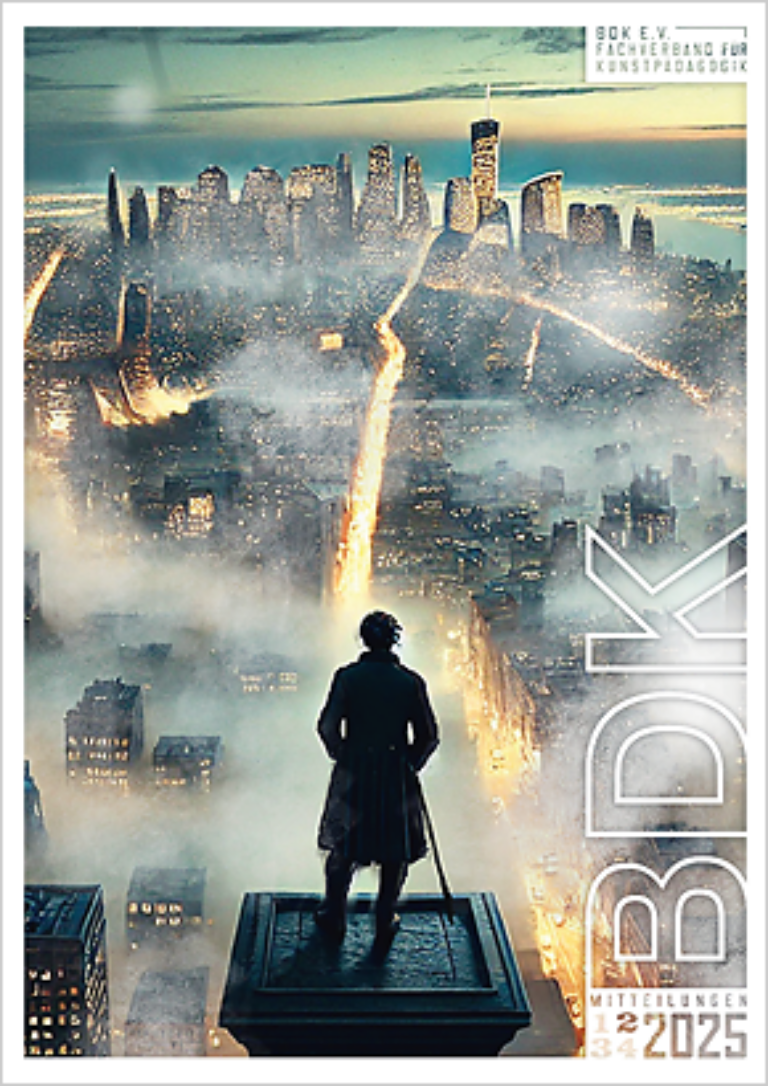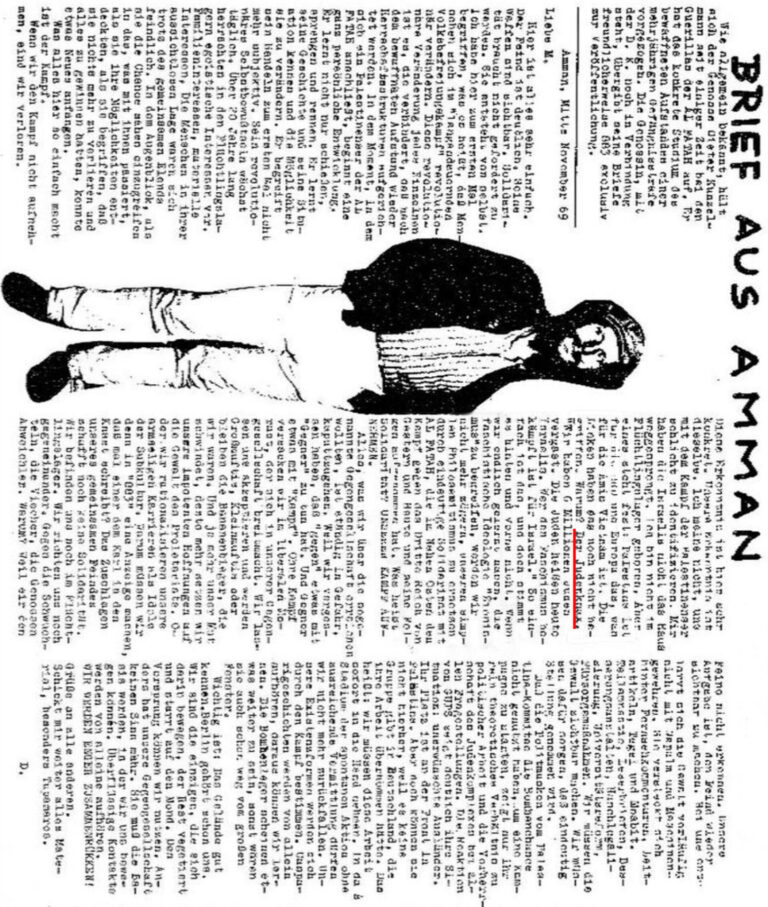Kommentar
Im Zeichen einer allgemeinen öffentlichen und vor allem der veröffentlichten Erregungskultur wird heute auf der Straße, im Feuilleton und in den sozialen Netzwerken grundsätzlich jedes Thema und jede Aktion zum Gegenstand leidenschaftlicher Parteinahmen und Kontroversen, wenn auch jeweils nur für eine kurze Zeit, bevor die Karawane schon wieder weiterzieht, zum nächsten Schockevent oder Skandal. Da muss man aber nicht immer sofort und mal kurz mitmachen.
Wie wir an den erregten und kontroversen Reaktionen auf die Karikaturen eines französischen Magazins, den damit verbundenen Terroranschlägen und nachfolgenden globalen Solidaritätsbekundungen und Massendemonstrationen erkennen können, will der gelassene und mündige Umgang mit Satire ebenso gelernt sein wie der mit allen anderen Bildern und Bildwelten.
Nicht jeder Mitbürger versteht und wertschätzt Ironie oder gar zynischen Sarkasmus. Für manche hört da der Spaß auf, wo sich andere über die eigenen Überzeugungen und Glaubenshaltungen mehr oder weniger taktlos lustig machen. Auch das verbriefte Recht auf Meinungsfreiheit ist insofern im Sinne seines verantwortlichen, erwachsenen Gebrauchs kein Freifahrschein. Ebenso wenig allerdings darf das Gegenteil, das generelle Verbot, Tabu und Verschweigen, in einer demokratisch verfassten Gesellschaft um sich greifen und bestimmte Gruppen für sich moralische Vorrechte beanspruchen. Soweit, so gut und richtig.
Genau hier liegen m. E. unsere Chance und unsere Verantwortung, als Lehrerinnen und Lehrer und als Dozentinnen und Dozenten, denn unsere Aufgabe ist nicht zuletzt die medien- und gesellschaftskritische Vermittlung von Bildkompetenz im Sinne einer nachhaltigen Aufklärung.
Die sittlichen, religiösen und interkulturellen Dimensionen unserer visuellen Kultur – zu der auch Karikaturen und Satiren aller Art als Prüfsteine der Meinungsfreiheit und Freiheit der Kunst gehören – situativ angemessen, sensibel und diskursoffen zu vermitteln, dabei weder grobschlächtigen Vereinfachungen noch zynischen Abwertungen das Wort zu reden und so zu einem etwas differenzierteren Verständnis des Wertes solcher Bilder, Texte und Filme beizutragen, das ist unser aller täglicher Auftrag. Der authentische und wirksamste Ort für diese Bildungsarbeit sind unsere Klassenzimmer, Seminarräume, Vorlesungssäle und Museen, überall in Deutschland, lange vor und noch lange nach „Charlie“.
Martin Klinkner, 26.01.2015