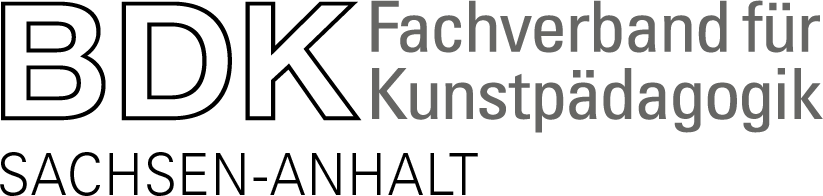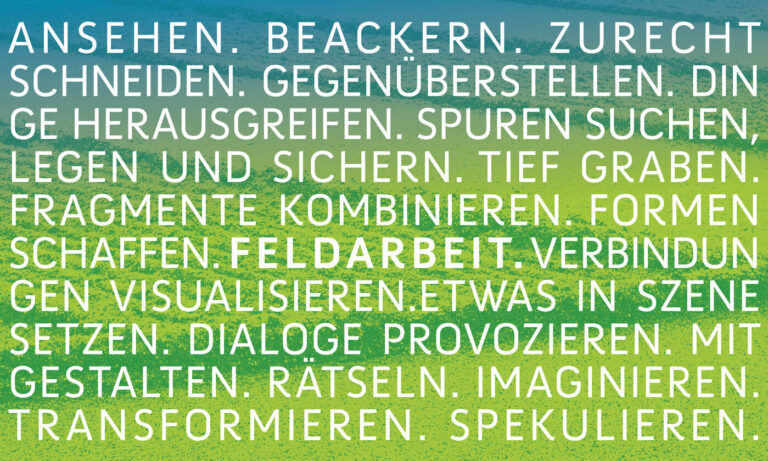Anne-Lena Fuchs und Sarah Kaiser
Erderwärmung, Artensterben, extreme Wetterereignisse: Die Grenzen des Wachstums, vor denen der Club of Rome schon 1972 warnte, sind in Zeiten globaler Krisen und gesellschaftlicher Herausforderungen deutlich spürbar. Die gegenwärtige Entgleisung der Ökosysteme und des öffentlichen Lebens bedingen ein Umdenken auf politischer und individueller Ebene. Und spätestens seit Greta Thunberg jeden Freitag die Schule bestreikte und sich öffentlich für einen nachhaltigeren Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten einsetzte, ist das Thema Nachhaltigkeit weltweit auch in den Schulen angekommen. Kinder und Jugendliche nehmen ihre Zukunft zunehmend selbst in die Hand und suchen — lokal und digital vernetzt — nach innovativen Handlungsalternativen, um den Bedrohungen für unseren Planeten kreativ zu begegnen.
Mit dem, was da ist. Nachhaltigkeit im Kunstunterricht.
Der kunstpädagogische Tag 2021 an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle (BURG), der in Kooperation des Landesinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) mit der Professur für Didaktik der bildenden Kunst an der BURG und dem Landesverband Sachsen-Anhalt des BDK e.V. Fachverband für Kunstpädagogik vom 17.-18. September 2021 stattfand, blickte mit dem Titel „Mit dem, was da ist. Nachhaltigkeit im Kunstunterricht“auf zukunftsorientierte Handlungsperspektiven. Das Veranstaltungsteam (www.burg-halle.de/mitdemwasdaist) stellte im Voraus folgende Fragen:
Wie arbeiten wir im kunstpädagogischen Kontext mit dem, was da ist? Was lässt sich ressourcenschonend gestalten und aus Vorhandenem improvisieren? Inwiefern liefern künstlerische Arbeiten Impulse für nachhaltige Entwicklungen? Lassen sich aus nachwachsenden Rohstoffen und biobasierten Materialien neue Substanzen und Objekte entwickeln, die keine weitere Belastung der Umwelt zur Folge haben? Wie kann digitale Technologie diese Entwicklungen unterstützen und um Möglichkeiten erweitern?
Mit diesen Leitfragen begegneten sich etwa 40 Lehrer:innen, Referendar:innen sowie Studierende im Rahmen von Vorträgen, praxisorientierten Workshops und Projektvorstellungen. Die Teilnehmenden lernten künstlerische und gestalterische Zugänge zu Themen nachhaltiger Entwicklung kennen, erprobten Arbeitsweisen wie auch Methoden und experimentierten im analogen und digitalen Raum forschend und spielerisch mit Materialien – insbesondere unter dem Blickwinkel einer kunstdidaktischen Übertragung.
dispose – reuse – recycle
Den Auftakt der Fortbildungsveranstaltung gestaltete Mareike Gast, Professorin für Industriedesign an der BURG, mit ihrem Vortrag Explorative Materialforschung für nachhaltige Zukünfte — Kunststoffe als nachhaltiges Kulturgut (Abb. 1). Im Zeitalter des Anthropozäns gilt Kunststoff als höchst ambivalentes Material. Es ist omnipräsent, günstig und universell einsetzbar. Gleichzeitig wird es als billiges und „böses“ Material verpönt, sodass sich viele Menschen zur Plastik-Abstinenz gedrängt sehen. Thomas Thwaites „Toaster Project” ist nur eine von vielen Parodien auf die Absurditäten unseres Rohstoffverbrauches und die Mengen an Elektroschrott, die wir in den letzten Jahrzehnten angehäuft haben. Wie stellen wir uns das in Zukunft vor? Die von Mareike Gast gezeigten Einblicke in Studierendenprojekte gaben zukunftsweisende Anstöße. Aufsprühbare Sneaker, die sich an den Fuß maßschneidern lassen, nachhaltige Gemüseverpackungen aus Ei-Membran oder die Mehlwurmzucht in der Großbäckerei inspirierten mit Mut zur Utopie, aber auch alltagspraktischen Ideen der Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaft.

Sensibilisiert für die Transformationspotenziale von Kunst und Design starteten die Teilnehmenden in zwei der vier anschließenden Workshops.
Was Gips, Braunkohle und Mikrowellen verbindet
Unter Anleitung von Henning Frančik experimentierten die Teilnehmenden des Workshops „Der Boden, auf dem wir stehen“ mit dem Geomaterial Gips. Woher kommt Gips? In welchen Kreislauf können wir das Material zurückführen? Lässt sich Gips aufschäumen und somit ressourcenschonender einsetzen? Wie lässt sich Gips recyceln — und was hat das mit Mikrowellen zu tun?Ausgehend von diesen Fragen verschaffte sich die Gruppe einen forschenden, produktiven Zugang zum Rohstoff. Denn wir stehen vor einem Problem: Mehr als die Hälfte des handelsüblichen Gipses ist sogenannter REA-Gips – ein Nebenprodukt der Braunkohleindustrie. Mit dem Kohleausstieg 2038 wird auch dieses wichtige Nebenerzeugnis verschwinden. Damit wächst das Interesse, das Material ressourcenschonend einzusetzen und in einem Materialkreislauf zu halten. So wurden im Workshop Strategien erster industrieller Gipsrecyclingwerke mit einfachen Mitteln nachempfunden und am Beispiel von Schaumgips ressourcensparende Herstellungsverfahren ausprobiert. Der Prozess glich einem Labor: Zwischen Rezepturen, Messinstrumenten und Rührschüsseln entstanden allerhand Materialproben, die zur weiteren Materialforschung und -verarbeitung einladen (Abb. 2).

Outdoor Dancefloor
Im Workshop „City Hacks“ vermittelte Sascha Henken vom Kollektiv plus x (kollektivplusx.de) verschiedene Strategien von Interventionen im urbanen Raum. Ausgehend von Leerstellen, unbeachteten Transitorten und vor allem eigenen Visionen für eine Belebung des Stadtraums setzten die Teilnehmenden unter anderem einen Pop-Up-Dancefloor (Abb. 3), einen Naturschutzraum im Miniaturformat oder eine Fotowand für Menschen mit Hunden um. Zur Verfügung standen einfache Materialien wie Pappe, Tape und bunte Farbe. Alles blieb temporär und sollte die Vorbeigehenden für kurze Zeit und mit einem Augenzwinkern zum Innehalten, Nachdenken oder zu spontanen Begegnungen anregen. Die öffentliche Resonanz fiel positiv aus und vor allem die Teamdynamik innerhalb der Workshopgruppe war ein Erlebnis.

Digitale Formen und Kneten ohne Knetmasse
Angeleitet von Nikos Probst bauten die Teilnehmenden im Workshop „Digitale Welten erschaffen“ eine eigene virtuelle Stadt. Das webbasierte Programm tinkerCAD ermöglicht Schritt für Schritt die Umsetzung digitaler Konstruktionsvorgänge und vermittelt die Möglichkeiten digitaler CAD-Technik bis hin zum 3D-Druck mit einfachen und spielerischen Mitteln (Abb. 4). Die beispielhafte Übertragung eines Entwurfes in den realen Raum konnte die Gruppe mit Hilfe eines 3D-Druckers live miterleben. Der Workshop gab außerdem Einblicke in kostenfreie Apps wie Qlone, DestroyPix, Goxel 3D Voxel Editor, Glitch Lab oder 3D Live Scanner und vermittelte verschiedenste Arten digitaler Gestaltung, die sich durch ihre intuitive Handhabung gut in den Unterricht einbauen lassen.

Sammlung als künstlerisches Mittel
Im Workshop „Sammlung als künstlerisches Mittel“ mit der Künstlerin Nina Zahl (Abb. 5) nutzten die Teilnehmenden alltägliche Dinge – Gefundenes, Überbleibsel und Weggeworfenes — als Ausgangspunkt für ästhetische Ordnungen und eigene Feldforschungen. Beim Beobachten, Suchen und Finden auf den Streifzügen um den Campus Design der BURG schärften sich der Blick und das Bewusstsein für das alltägliche Umfeld und seine Relikte. So entstanden Sammlungen von Artefakten — von kleinen bedruckten Verpackungsresten, weggeworfenen Kassenbelegen, bunten Schraubdeckeln, Zigarettenfiltern, Haargummis, leeren Tablettenstreifen, Steinen und Federn bis hin zu ausgetrunkenen Sektflaschen. Sortiert, kategorisiert und arrangiert begannen die Dinge, von den in ihnen gespeicherten Informationen, Erinnerungen und Geschichten zu erzählen. Oder sie verwiesen auf die künstlerische Sammlung selbst, auf ihr Arrangement, eigensinnige Ordnungskategorien und neu entstehende Zusammenhänge.

Material literacy
Dr. Sara Burkhardt, Professorin für Didaktik der bildenden Kunst, rundete das Programm mit dem Einblick in ihre Lehre ab. Im Projekt „Object Lessons” nahmen Studierende Bezug auf das pädagogische Werk von Elisabeth Mayo (1793-1865) und deren Bruder Charles Mayo (1792-1846), welche Anweisungen zur Vermittlung von Objekten und Materialproben aus dem Alltag des 19. Jahrhunderts entwickelt haben. Die Materialkästen der Mayos wurden aktualisiert und im Rahmen eines Unterrichtsprojektes zu Nachhaltigkeit und Klimawandel praktisch erprobt.
Der anschließende Gang durch die Materialsammlung der BURG schlug den Bogen zum Verständnis einer zeitgemäßen Materialbildung, welche Schüler:innen heute für einen bewussten Umgang mit der materiellen Welt sensibilisieren soll. Eine solche ,material literacy’ ist auch ein Ziel des Forschungsprojektes BurgMaterial, in dem narrative Dimensionen von Materialien untersucht und Vermittlungsformate für die Materialsammlung entwickelt und erprobt werden. Sarah Kaiser, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt, diskutierte mit den Teilnehmenden des Fachtages in der Ausstellung SOLUM, wie sich unsichtbare Geschichten, in denen Materialien eingebettet sind — etwa die Bedingungen ihrer Entstehung, historische Gebrauchskontexte oder symbolische Bedeutungsebenen — vermitteln lassen.
Nachhaltigkeit und Experiment
Der Fachtag hat Möglichkeiten für eine nachhaltige Bildung im Kunstunterricht aufgezeigt, die mit dem, was da ist, kreativ und konstruktiv umgeht. Denn Künstler:innen wie auch Designer:innen eröffnen neue Experimentier- und Denkräume, bringen positive Erzählungen und unkonventionelle Beiträge zum Nachhaltigkeitsdiskurs hervor. Damit gehen sie auch neue Wege, Probleme der Gegenwart zu reflektieren und den kulturellen und gesellschaftlichen Wandel zu gestalten. Der Fachtag hat damit ein weiteres Mal gezeigt, welche Bedeutung dem gemeinschaftlichen, multiperspektivischen Denken, Austauschen und Entwickeln zukommt und nicht nur neue Kontakte knüpfen lassen, sondern vielleicht auch den fachdidaktischen Dialog auf einen neuen Kurs gebracht.
Anne-Lena Fuchs ist Künstlerin und derzeit Referendarin für die Fächer Kunst und Deutsch am Christian-Wolff-Gymnasium in Halle (Saale). E-Mail: anne.lena.fuchs@gmail.com, Web: annelenafuchs.com
Sarah Kaiser ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt BurgMaterial an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle.
E-Mail: skaiser@burg-halle.de