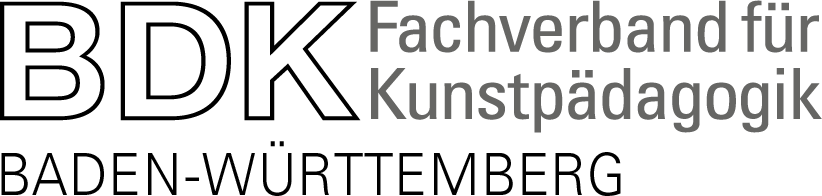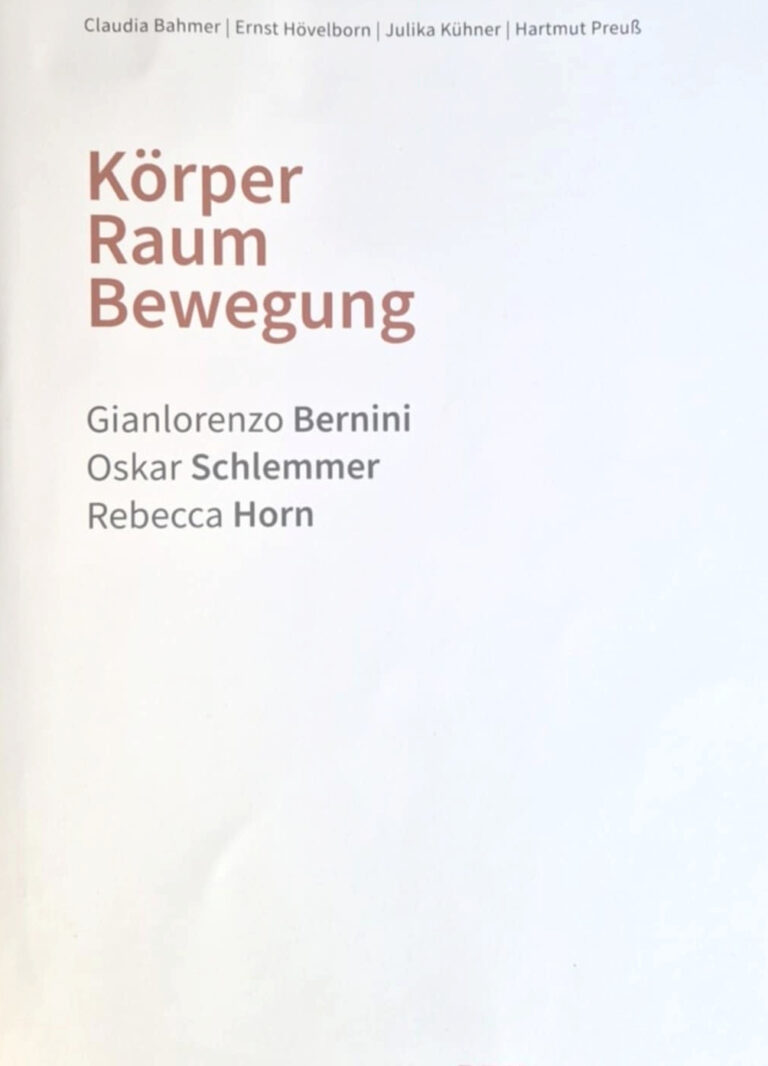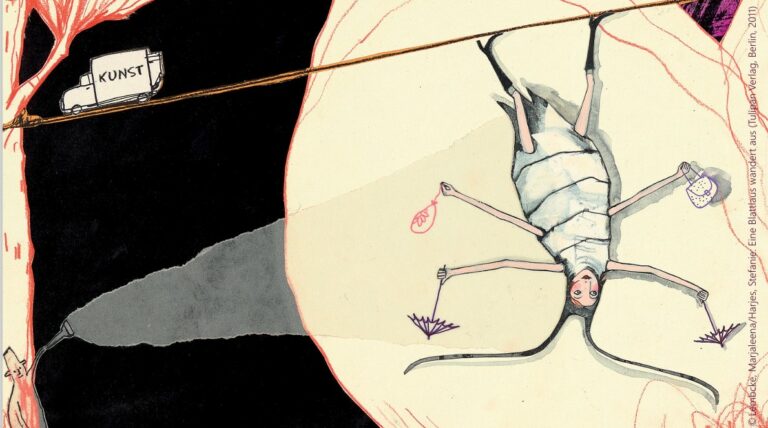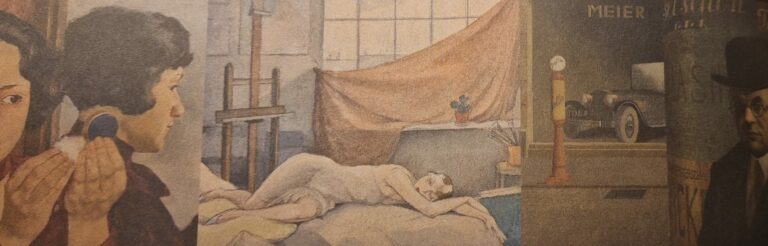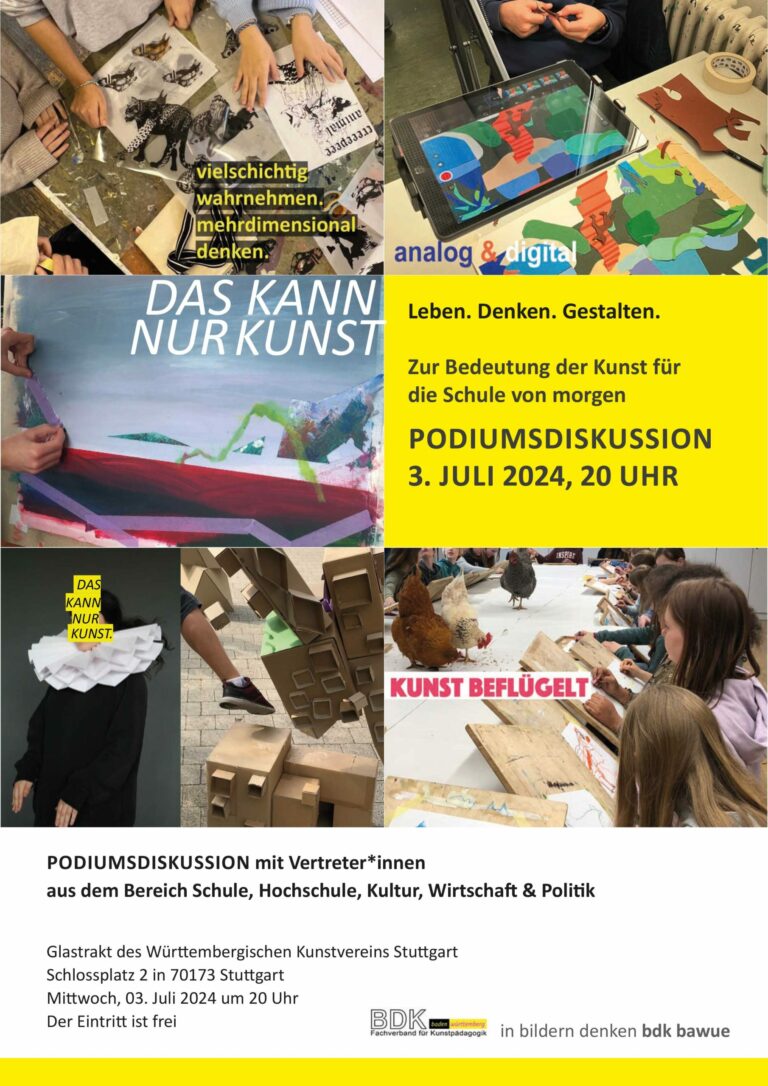Fast 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich zwischen Donnerstag, dem 22. Oktober, und Sonntag, dem 25. Oktober 2009, zum Bundeskongress des BDK und der Kunstakademie Düsseldorf ein. Dass so viele Interessierte, – LehrerInnen, DozentInnen, ProfessorInnen, StudentInnen, nunmehr im schon zur Gewohnheit gewordenen zweijährigen Rhythmus der Einladung des BDK folgen und an einen Ort der Kunst, der Studien und der Wissenschaft in Deutschland reisen, um sich dort auszutauschen, ist uneingeschränkt zu begrüßen und auch dieses Jahr den Veranstaltern und Organisatoren wieder ganz positiv anzurechnen. Herzlichen Dank allen hierfür. Solche Veranstaltungen müssen auch weiterhin wie helle Leuchtfeuer in der bildungspolitisch dunklen Ebene der vernachlässigten Wahrnehmung der Kunstpädagogik aufflammen.
Dieses Jahr schrieb sich der Bundeskongress das Thema ‚Orientierung Kunstpädagogik’ auf die Fahnen. Das weckte breite, ja höchste Erwartungen, – Richtungsweisung und Auseinandersetzung zugleich -.
Leider löste sich diese Hoffnung in den tragenden Beiträgen des
Kongresses nicht umfassend ein. Vielmehr wurde den TeilnehmerInnen rasch
klar, dass eine stringente Kongress-Dramaturgie zwar in den
vielfältigen Sektionen (Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Themen und
ReferentInnen) Pluralität gelten ließ, in den Leitvorträgen jedoch eine
klare Strategie der Beförderung des Konzepts ‚Bildorientierung’
zugunsten einer Unterwerfung, bisweilen sogar einer Diffamierung des
Konzepts ‚Künstlerische Bildung’ verfolgte.
(Vor einigen Jahren besuchten wir hierzulande in Heidelberg und
Karlsruhe mit einigem Bedauern entsprechende Kongresse unter umgekehrten
Vorzeichen.)
Von Anbeginn der Kunsterziehungsbewegung vor über 100 Jahren stritten die Konzepte „Erziehung durch Kunst“ oder „Erziehung zur Kunst“ miteinander und rieben sich in ihren Pendelschwüngen dann doch immer wieder befruchtend aneinander.
In seinem prononcierten Vortrag „Kunstpädagogik in einer sich ändernden Gesellschaft“ räumte Hubert Sowa (Prof. für Kunstdidaktik an der PH Ludwigsburg) gehörig mit der Fachentwicklung seit den 1960er Jahren auf: Gunter Ottos Konzept der ‚Kunst als Prozess im Unterricht’, die Ideen der Visuellen Kommunikation und Gert Selles ‚Gebrauch der Sinne’ wurden als didaktische Nebenwege herabgemindert und als Sackgassen verworfen. Hingegen blieb die Forderung nach einer neuen Orientierung am Bild (-werk, nicht am Kunstwerk, zugleich am Rückzug auf Bedeutendes der Weltkunstgeschichte als Kulturgut), an einer neuen Kultivierung des Handwerks (man denke an Richard Sennetts Buch ‚Handwerk’, 2008) und die Besinnung des Faches Bildende Kunst auf seine engen Grenzen und eigenen Möglichkeiten, in Absetzung gegenüber anderer Bereiche wie Musik, Darstellendem Spiel, Theater, Performance, etc. als Forderung für ein gesamtcurriculares Konzept im Raume stehen.
‚Bildorientierung’ versus ‚Kunstorientierung’ erschien mir keinerzeit wirklich plausibel.
Gesamtcurriculare Ideen des Sehens und Gestaltens für die Kinder vom
Sandkasten bis zur Reifeprüfung vermochten mich ebenfalls noch nie zu
überzeugen.
Handwerk ist fundamental wichtig, kann jedoch allein und in enger Ausschließlichkeit nicht zur Innovation führen. Nur jene Tafelmaler, die im Mittelalter im Auftrag von Theologen oder Stiftern und im Hinblick auf bestimmte religiöse Funktionen ( – also meinetwegen halt keine ‚Kunstwerke’! – ) sondern einfach ‚Bilder’ schufen, dabei aber gerade die geläufigen Konventionen ihres Handwerks sprengten, sind uns bis heute allein als besondere und bedeutende Bild-Schöpfer gegenwärtig geblieben.
Das Brechen des Eingeübten, das Verweigern des Überkommenen sind
neben Tradition, Wiederholung und Fortschreibung aller kultureller
Errungenschaften deutliche und markante Wesensmerkmale künstlerischen
Handelns und künstlerischen Selbstverständnisses. Warum man denn Worte
und Eigenschaften wie künstlerischer „Eigensinn“ nun nicht mehr in den
Mund nehmen dürfe, damit kultureller „Gemeinsinn“ wieder ins Feld
geführt werden dürfe, bleibt mir in seiner kontroversen
Ausschließlichkeit einfach schleierhaft.
Ist die Lokalisierung einer definierten ‚Mitte des Faches’ wirklich zu leisten?
Ist Kunstpädagogik denn ausschließlich eine kanonisiert verankerte geisteswissenschaftliche Disziplin? – wohl kaum!
Dieser Tage fielen mir die zwei Jahre alten BDK-Mitteilungen 3/07
wieder in die Hände, die den Dortmunder Kongress von 2007 aufarbeiteten.
Im Leitartikel von Timo Bautz („Kontur oder Mixtur?“, S. 2) wurde schon
dort der Streit der Konzeptionen, – die landläufig in der
Unterrichtspraxis der Schulen eher nebeneinander oder als Mischformen
umgesetzt werden -, analysiert:
(Man kann) „in der Wiederkehr oder Resistenz der (…) Konzeptionen
zunächst eine Bestätigung der Geschichte des Faches sehen, allerdings
mit einer sich abzeichnenden neuen Tendenz: Je länger die gegenläufigen
Zielperspektiven nebeneinander in Anspruch genommen werden, umso
deutlicher werden ihre Horizonte, vielleicht auch die strukturellen
Unterschiede und Grenzen wahrgenommen.“
Bei bestimmten Anlässen, offenbar besonders bei Kongressen brechen an diesen Grenzen die Grabenkämpfe zwischen den jeweiligen Verfechtern offen auf, treiben neben der fachdidaktischen Auseinandersetzung doch besonders auch individuelle und persönliche Eitelkeiten ihre Blüten!
Ich plädiere für eine offene Begegnung unterschiedlicher fachdidaktischer Positionen, ‚in personae’, in Wort, Bild, mit fairem Blick auf jede vorgetragene Argumentation.
Der baden-württembergische Landesvorstand des BDK unterstützt zusammen mit mir alle Initiativen, die zu einer Begegnung und vor allem zu einem konstruktiven Austausch der vielfältigen fachdidaktischen Positionen führen.